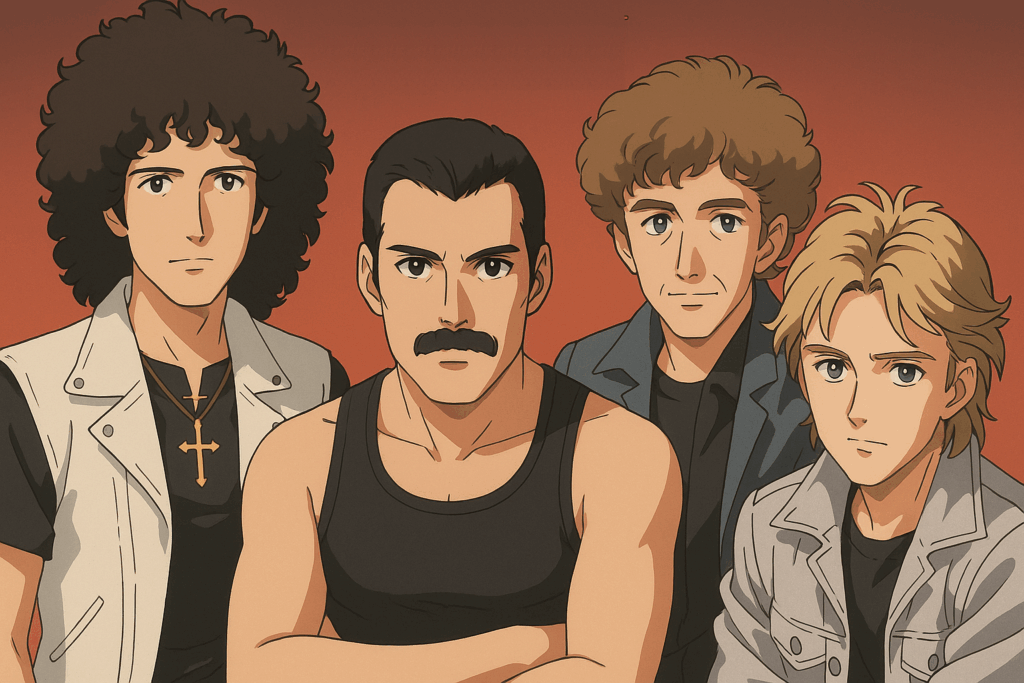
Queen kehren 1984 mit ihrem Studioalbum The Works eindrucksvoll zurück: Ein Album, das sowohl musikalisch als auch technisch neue Wege beschreitet – und dabei an frühere Rocktugenden anknüpft. Von den Aufnahmen in Los Angeles und München über den synthetischen Beat der Linn LM-1 Drum-Machine bis zum weltweiten Erfolg von „Radio Ga Ga“: Dieses Album markiert einen Wendepunkt in Queens Karriere.
Das Album markierte Queens elftes Studioalbum und eine Rückbesinnung auf rockigere Klänge. Nach einer schöpferischen Pause im Jahr 1983 fanden Queen im Sommer jenes Jahres wieder zusammen, um an ihrem elften Studioalbum zu arbeiten. Die Aufnahmen zu The Works erstreckten sich schließlich über ein halbes Jahr – von August 1983 bis Januar 1984. Eine Besonderheit: Erstmals in ihrer Karriere nahm die Band in Nordamerika auf. Die Sessions begannen im August ’83 in den Record Plant Studios in Los Angeles und wurden später im Münchner Musicland-Studio fortgesetzt. Produziert wurde The Works von Queen selbst in Zusammenarbeit mit ihrem bewährten Engineer Reinhold „Mack“ Mack, der schon bei früheren Alben an den Reglern saß. Unterstützt wurden sie zudem vom jungen Toningenieur David Richards in München. Diese transatlantische Arbeitsweise – erst Kalifornien, dann Bayern – war für Queen Neuland und prägte den Sound des Albums.
Technisch ging die Band bei den Works-Sessions neue Wege. Elektronische Instrumente und frühe Drum-Computer spielten eine zentrale Rolle, was eine spannende Mischung aus Rock und Synthesizer-Pop ergab. Bereits seit dem Vorgänger Hot Space (1982) experimentierten Queen mit dem Linn LM-1 Drum-Computer, einer der ersten digitalen Drum-Machines. Bassist John Deacon hatte das Gerät 1981 angeschafft, und die Band nutzte es ausgiebig – oft bis an die Belastungsgrenze. Tatsächlich war das Team so begeistert von den neuen Rhythmus-Möglichkeiten, dass der LM-1 in München zeitweise repariert werden musste, weil „gewisse Musiker“ die Pads übermäßig malträtierten. Parallel nutzte man auch den neueren LinnDrum (LM-2); beide Geräte wurden 1983 sogar mit einer speziellen MIDI-Sync-Modifikation versehen, um im Studio synchron laufen zu können.
Queen integrierten diese Drum-Machines nahtlos in ihr Songwriting – Roger Taylor programmierte die Beats auf einer Maschine, ohne auf seinen charakteristischen Drumsound zu verzichten. Neben den Linn-Geräten kamen weitere Synthesizer wie der Oberheim OB-Xa und der Roland Jupiter-8 zum Einsatz. Letzterer lieferte dank eingebautem Arpeggiator treibende Bass-Sequenzen, die den Songs eine futuristische Note gaben. Gleichzeitig steuerte Gastkeyboarder Fred Mandel, den Queen erstmals von ihrer Tourband ins Studio holten, zusätzliche Keyboard-Parts bei – sowohl organische Piano-Passagen als auch Synthesizer-Flächen bereicherten den Sound. Diese Verbindung aus neuester Technik und klassischem Queen-Handwerk sollte sich als erfolgreiches Rezept erweisen.
Trotz aller Elektronik verlor die Band nie die kollektive Arbeitsweise aus den Augen. Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor und John Deacon teilten sich wie gewohnt Songwriting und Arrangement-Ideen. Während der Sessions entstand ein kreativer Austausch: Jeder brachte Songskizzen mit, die gemeinsam verfeinert wurden. So fungierten Queen faktisch als Selbstproduzenten-Team, mit Mack als klingendem „fünften Mitglied“ im Kontrollraum. Die Devise, die Roger Taylor zu Beginn ausgab, lautete programmatisch: „Let’s give them the works!“ – „Lasst uns ihnen alles bieten!“ Genau dieses Motto spiegelt sich im Albumtitel The Works wider und beschrieb treffend die Herangehensweise: Queen wollten 1984 ein musikalisches Gesamtpaket abliefern – mit harten Rockriffs, großen Hymnen und modernen Klangexperimenten.
Einer der herausragenden Tracks des Albums ist „Radio Ga Ga“, geschrieben von Drummer Roger Taylor. Die Inspiration zu diesem Song kam auf eher ungewöhnliche Weise: Roger hörte in Los Angeles seinen kleinen Sohn über einen schlechten Radiosong mäkeln – mit den Worten „Radio ca-ca“ (Kinderkauderwelsch für „Radio Kacka“). Diese scherzhafte Phrase blieb hängen. Taylor erkannte darin einen passenden Titel für einen Song und machte sich sofort ans Werk. Er schloss sich drei Tage lang in ein Studio ein, ausgerüstet nur mit einem Synthesizer (einem Roland Jupiter-8) und einer LinnDrum-Drum-Machine, um an dem Stück zu feilen. Was ursprünglich als Beitrag für sein geplantes Soloalbum gedacht war, entwickelte sich zu einer Hommage an die goldene Ära des Radios – und einer subtilen Medienschelte im MTV-Zeitalter.
Musikalisch ist „Radio Ga Ga“ ein gelungenes Beispiel für Synthie-Pop trifft Stadion-Rock. Der Song beginnt mit einem pulsierenden, elektronischen Herzschlag-Rhythmus aus dem Drum-Computer, der sofort ins Ohr geht. Darüber legt sich ein markanter Vocoder-Effekt – Fred Mandel programmierte einen Roland-Vocoder, der der Gesangslinie in den Strophen einen futuristischen Klang verlieh. Die Strophen klingen dadurch zugleich nostalgisch und modern, was perfekt zum Text passt: Taylor besingt darin nostalgisch die gute alte Radiozeit und beklagt, dass im Fernseh- und Videozeitalter das Visuelle die Musik zu verdrängen droht. In Interviews betonte er, es mache ihm Sorge, dass Musikvideos wichtiger würden als die Musik selbst – „Musik ist für die Ohren, nicht für die Augen“, so Taylor pointiert.
Doch erst der Refrain von „Radio Ga Ga“ entfaltet die volle Queen-Wucht: Eine eingängige, hymnische Melodie, die zu Mitklatsch-Rhythmen einlädt. Tatsächlich integrierte die Band zwei klatschende Schläge (die berühmten „Ga Ga“–Handclaps) im Refrain, die zum Markenzeichen des Songs wurden. Hier mischen sich programmiertes Schlagzeug und echtes Händeklatschen zu einem unwiderstehlichen Groove. John Deacon steuerte einen treibenden Basslauf bei – teils klassisch am E-Bass, teils als arpeggierte Synth-Basslinie vom Jupiter-8 geliefert. Über allem thront Freddie Mercurys kraftvoller Gesang, der den von Roger ersonnenen Song auf ein neues Level hob.
Bemerkenswert ist, wie sehr „Radio Ga Ga“ zur Teamarbeit wurde, obwohl Roger Taylor als alleiniger Autor gilt. Als Taylor den Song seinen Bandkollegen vorstellte, erkannten diese sofort das Hitpotenzial. Besonders Freddie Mercury war begeistert und half dabei, den Track zu veredeln – er feilte an Melodie, Harmonien und Arrangement, um dem Stück den letzten Feinschliff zu geben. Roger selbst zog sich währenddessen sogar in den Skiurlaub zurück und vertraute Freddie die Fertigstellung an. Das Resultat war ein perfektes Zusammenspiel aus Rogers ursprünglicher Idee und Freddies Sinn für große Pop-Momente. Brian May erinnerte sich, dass Roger den Song zunächst „nur als weiteren Albumtrack“ ansah, während Mercury sofort eine „starke, eingängige Hymne“ darin erkannte. Genau so kam es: „Radio Ga Ga“ wurde zum Opener von The Works und erschien im Januar 1984 – einen Monat vor Albumveröffentlichung – als erste Single.
Begleitet wurde der Song von einem aufwändigen Musikvideo, das Roger Taylors Thematik visuell aufgriff. Regisseur David Mallett montierte futuristische Szenen aus Fritz Langs Stummfilmklassiker Metropolis (1927) mit Aufnahmen der Band. Im Video fliegen Queen in einer retro-futuristischen Stadtlandschaft umher, umgeben von Arbeiter-Massen – eine Referenz an Langs Vision einer von Maschinen beherrschten Metropole. Diese Sci-Fi-Ästhetik passte ideal zum Song, der ja den Fortschritt (TV, Video) gegenüber dem alten Radio thematisiert. Das Publikum war begeistert: „Radio Ga Ga“ lief in heavy rotation auf MTV und anderen Musiksendern. Bei den allerersten MTV Video Music Awards 1984 erhielt das Video sogar eine Nominierung für das „Best Art Direction“ (Beste Ausstattung). Spätestens mit diesem cineastischen Clip bewies Queen, dass sie auch visuell im neuen Jahrzehnt mithalten konnten – ironischerweise mit einem Lied, das die Übermacht des Visuellen kritisch beäugt.
Sowohl das Album The Works als auch „Radio Ga Ga“ entwickelten sich zu weltweiten Erfolgen und markierten ein großes Comeback für Queen in der Mitte der 1980er. Die Single „Radio Ga Ga“ erreichte Platz 1 in 19 Ländern weltweit – von Europa bis Südamerika sangen Fans im Chor „all we hear is Radio Ga Ga“. In Queens Heimat Großbritannien kletterte der Song bis auf Platz 2 der Charts und blieb dort wochenlang in den Top 10. In den USA schaffte „Radio Ga Ga“ es in die Top 20 der Billboard-Charts – es sollte dort der letzte Top-40-Hit der Band mit Freddie Mercury zu seinen Lebzeiten sein, was dem Lied rückblickend besondere Bedeutung verleiht.
Auch die Nachfolgesingles aus The Works waren erfolgreich: „I Want to Break Free“, „It’s a Hard Life“ und „Hammer to Fall“ stürmten die europäischen Hitparaden. Insbesondere „I Want to Break Free“ wurde – begleitet von einem berühmt-berüchtigten Video in dem die Bandmitglieder als Hausfrauen verkleidet waren – ein weiterer Klassiker, der Queens Popularität festigte (wenngleich das Video in den USA kontrovers aufgenommen wurde).
Das Album The Works selbst platzierte sich hoch in den Albumcharts und verkaufte sich auf lange Sicht millionenfach. In Großbritannien verpasste das Album zwar knapp die Spitze, erreichte aber Platz 2 der Charts. Vor allem beeindruckte die Dauerpräsenz: The Works blieb unglaubliche 94 Wochen in den britischen Charts und stellte damit einen Rekord für ein Queen-Studioalbum auf. Bereits innerhalb weniger Wochen nach Release hatte die Platte Gold- und Platin-Status erreicht. Weltweit wird der Absatz auf über sechs Millionen Exemplare geschätzt – ein Beleg dafür, dass Queen mit diesem Album wieder den Nerv des Publikums trafen.
Kritiker reagierten größtenteils positiv. In Großbritannien sah man The Works als gelungene Trendwende: Nach dem polarisierenden, disco-funkigen Hot Space kehrten Queen „zu ihren Rockwurzeln und dem traditionellen Queen-Sound“ zurück, wie zeitgenössische Rezensionen feststellten. Das Musikmagazin Record Mirror feierte das Album gar als „another jewel in the crown“ – ein weiteres Juwel in der Krone der Band. Diese Anerkennung unterstrich, dass Queen 1984 wieder in Topform waren.
Nicht zuletzt entfaltete The Works auch eine enorme kulturelle Strahlkraft. Die Songs entwickelten sich zu festen Größen in Queens Live-Shows. „Radio Ga Ga“ avancierte zur Stadion-Hymne: Bei Konzerten – allen voran beim legendären Live Aid 1985 – klatschten Zigtausende Fans synchron über dem Kopf den „Ga Ga“-Beat, ein Bild, das um die Welt ging. Dieser simple, aber effektvolle Mitmach-Part wurde zu einem der Markenzeichen von Queen-Auftritten in den 80ern, ähnlich ikonisch wie das Fußstampfen bei „We Will Rock You“. Auch „I Want to Break Free“ mit seiner Botschaft von Freiheit und der provokanten Video-Optik hinterließ kulturell Eindruck und wird bis heute gerade in Europa und Südamerika als inoffizielle Freiheits-Hymne mitgesungen.
Im Kontext von Queens Karriere bedeutete The Works somit eine Erneuerung und Festigung ihres Status: Das Album bewies, dass die Band nach über einem Jahrzehnt im Geschäft noch immer Hits liefern konnte, die sich ins kollektive Popkultur-Gedächtnis einbrennen. Es ebnete den Weg für Queens triumphale Mitte-80er-Phase – vom Live-Aid-Triumph bis zur abschließenden Magic Tour 1986. Sogar jenseits der 80er hallt das Erbe nach: Die amerikanische Popkünstlerin Lady Gaga wählte ihren Künstlernamen als Hommage an Queens Songtitel „Radio Ga Ga“.
Mit The Works legten Queen 1984 ein Album vor, das Technik und Tradition gekonnt verbindet. Einerseits wagte die Band den Schritt ins elektronische Zeitalter – mit Drum-Machines (Linn LM-1), Synthesizern und modernen Produktionstechniken, die dem Zeitgeist entsprachen. Andererseits besannen sich Queen auf ihre Kernstärken: mitreißende Rocksongs, opulente Arrangements und die stimmliche Brillanz Freddie Mercurys. Dieser Brückenschlag zahlte sich aus – kommerziell, kritisch und kulturell. The Works wird heute als erfolgreiches Comeback-Album angesehen, das Queens Stellung als eine der größten Rockbands festigte. Von der Studioknöpfchendreherei in LA und München bis hin zu den klatschenden Massen bei „Radio Ga Ga“ hat The Works gezeigt, dass Queen auch in den 80ern „the works“ liefern konnten – eben das volle Programm.
Der Beat von Radio Ga Ga besteht aus 2 Patterns mit einer Länge von jeweils 16 Steps, also insgesamt 32 Steps. Das Tempo beträgt 112 bpm. Die KICK kommt auf die Zählzeit 1 und 3, das sind die Steps 1 und 9. Hinzu kommt der Schlag, der den Beat so unverkennbar macht: Die 16tel Note auf Step 2 in Pattern 1.
Wie bei einem klassischen Rockbeat üblich, erklingt die SNARE im Backbeat auf die Zählzeit 2 und 4, das sind die Steps 5 und 13. Auf der geschlossenen HI-HAT werden 16tel gespielt. Außer in Pattern 2 auf den Steps 15 und 16, denn diese Steps werden von der offenen HI-Hat auf Step 15 überdeckt. Die MARACAS groovt im Offbeat. Das sind in Pattern 1 und 2 jeweils die Steps 3, 7, 11 und 15.